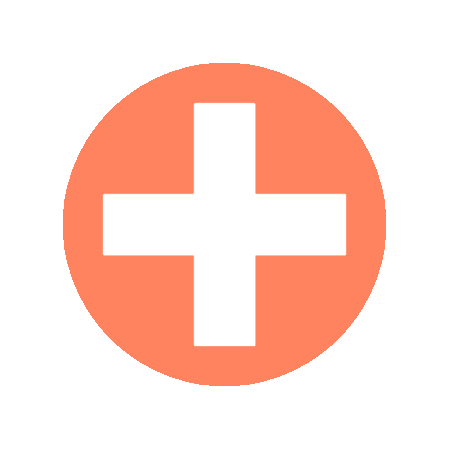Wir trafen Lölja Nordic, eine junge oppositionelle Exilrussin, Ende Juli im antifaschistischen Camp in Südkärnten bei Zelezna Kapla/ Bad Eisenkappel. Das Camp fand dieses Jahr an der NS-Gedenkstätte Peršmanhof statt und wurde aus fadenscheinigen Gründen von Einsatzkräften der Polizei gestürmt.* Lölja ist aktiv in der feministischen Anti-Kriegs-Bewegung «The Feminist Anti-War Resistance».
Archipel: Lölja, du kommst aus St. Petersburg und studierst jetzt in Wien. Der Peršman Hof liegt da nicht gerade auf der Strecke, was bedeutet dieser Ort für dich?
Lölja: Zum ersten Mal war ich 2024 beim Antifa-Camp, vorher hatte ich nie etwas von diesem Ort gehört und nichts vom Widerstand der Kärntner Slowen·innen gewusst. Die Bedeutung des Partisanen·innenkampfes im Zweiten Weltkrieg war mir unbekannt. Hier im Museum habe ich viel erfahren, habe weiter recherchiert und bin erstaunt, ja tief beeindruckt von all dem. Als ich hörte, dass das Antifa-Camp jedes Jahr stattfindet, bin ich gerne hergekommen. Als Feministin und Antifaschistin im aktiven Widerstand gegen den russischen Faschismus hat mich die tragende Rolle der Frauen im Widerstand sofort angesprochen.
Helena Kuchar-Jelka (eine slowenische Kärntner Partisanin, Anm. d. Red.) hat immer wieder erklärt, dass Widerstand im Alltag stattfindet und wenig mit Heldentum zu tun hat. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Es ist eine sehr feministische Perspektive. In einer patriarchal organisierten Welt voller toxischer Maskulinität wird Widerstand oft durch radikale Aktionen, Proteste, heldenhaften Militarismus definiert; selten als Aktivitäten im Alltag, die oft unspektakulär erscheinen und doch so existentiell sind. Für mich ist Widerstand ein breites Spektrum, in welchem der heroische Aspekt an der Front gegen die Nazis oder gegen die Polizei zu kämpfen nur ein sehr kleiner ist. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit viel mehr der Bildung und der Aufklärung widmen. Mehr auf kulturelle Vielfalt, Care-Arbeit, Kooperation und gesellschaftlichen Zusammenhalt achten, vor allem bei politisch und sozial vulnerablen Personen. In meiner Erfahrung als politische Aktivistin liegt diese tägliche Routine meistens auf den Schultern der Frauen. Es ist unsichtbare, langweilige Arbeit, die jedoch unabdingbar ist und getan werden muss.
Ich beobachte, dass Männer in politischen Bewegungen und selbst in der radikalen Linken diese Trennung zwischen Aktivismus und Alltagsarbeit machen. Auch deshalb bin ich Feministin, weil es keine Hierarchie in den Aufgabenbereichen geben sollte. Alltagsarbeit ist auch deswegen unsichtbar, weil in der Geschichte von grossen Namen und heroischen Taten des Widerstands erzählt wird, aber nicht von dessen Voraussetzung, nämlich der Arbeit im Hintergrund.
Noch ein Bezug zu Jelka. Sie war eine Frau ohne besondere Schulbildung und aus einem einfachen Umfeld. Die Zeiten waren schwierig und die Präsenz der Nationalsozialisten erdrückend. Kurierdienste oder Versorgung der Partisan·innen waren sehr gefährlich, nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kinder. Hier im Westen hören wir, dass in Russland jegliche Opposition unmöglich ist. Wie erlebst du das?
Das eiserne Regime von Putin ähnelt zunehmend einer Diktatur; offene Proteste auf der Strasse sind nicht mehr möglich. Wir haben etliche Demonstrationen organisiert mit dem Ergebnis, dass viele Menschen ins Gefängnis gekommen sind, harte Repressionen erleben, es gibt Folter bis hin zu Mord. Die letzte Welle grosser Strassenaktionen war 2022 gegen den Überfall auf die Ukraine. In mehreren Städten protestierten Abertausende Menschen, obwohl sie sich des Risikos bewusst waren. Es gab massenhaft Verhaftungen und die Repression ist nochmal härter geworden. Wir wissen von 2000 politischen Gefangenen, die Dunkelziffer ist sicher höher, da manche keinen Zugang zu sozialen Netzen haben, vielleicht irgendwo in einer Kleinstadt eingesperrt sind und niemand weiss, dass sie politische Gefangene sind. Wegen des brutalen Vorgehens der Polizei musste die Opposition untertauchen. Opposition in Russland ähnelt jetzt eher dem Partisan·innenwiderstand: Der Kampf gegen das Regime geschieht im Geheimen: Agitation gegen den Krieg, Verteilen von Flugblättern, Umgehen des Einberufungsbefehls, Zurückholen von Soldaten auf legalem Wege von der Front. Viele wurden zur Armee gezwungen oder erpresst. Russen und Russinnen unterstützen die gewaltsam Vertriebenen aus den jetzt russisch besetzten Gebieten. Hunderttausende Menschen wurden vom Militär in unterschiedliche Regionen verschleppt, sind dort auf humanitäre Hilfe angewiesen oder brauchen Unterstützung, um in die Ukraine zurückzukehren. All das wird von russischen Staatsbürger·innen in Graswurzelbewegungen organisiert.
Es gehört auch zum Widerstand, die zahlreichen politischen Gefangenen zu versorgen. Das Regime will, dass sie unsichtbar sind, ihre Namen von der Welt vergessen werden, dass sie im Gefängnis elend verrotten. Russische Staatsbürger·innen veröffentlichen ihre Geschichten und sammeln Geld, um Anwälte zu bezahlen. Wenn du zu 20 Jahren Haft verurteilt bist, ist ein Anwalt besonders wichtig, da er oft als Einziger eine Chance hat, ein Besuchsrecht zu erwirken, dich zu sehen und somit einen Bezug zur Aussenwelt herzustellen. Russische Gefängnisse sind eine kostspielige Angelegenheit; ohne Geld überlebt man nicht. Essen, Medikamente, saubere Kleidung, der ganze Lebensunterhalt, für alles muss Geld gesammelt werden oder die Familie muss zahlen. Würde mir das passieren, ich hätte null Unterstützung von meinen Angehörigen. Ein Aspekt des Widerstands ist auch, dass die Gefangenen überleben. Solange sich jemand um sie kümmert, sie nicht vergessen sind, gibt es eine grössere Chance, nicht zu Tode gefoltert zu werden.
Hunderte von Leuten haben auch radikalere Partisan·innenaktionen durchgezogen: etwa Mobilisierungsbehörden der Armee in Brand gesteckt und Dokumente vernichtet. Dadurch wurde die Einberufung etlicher Soldaten verzögert, weil viele amtliche Strukturen noch nicht digitalisiert sind. Schienenstränge zur Versorgung der Front mit militärischer Ausrüstung wurden gesprengt, ganze Züge gingen verloren; die Kriegsmaschinerie wurde so verlangsamt. Zum Glück wurden die meisten der Akteur·innen nicht ertappt. Aber einige haben sie doch erwischt, sie wurden zu 20 bis 25 Jahren schwerer Haft verurteilt und schlimm gefoltert. Ausserhalb Russlands ist dieser Widerstand – trotz der enormen Risken – leider nicht bekannt. Wenn ich hier Zeitungen lese, steht da nur, dass alle hinter Putin stehen – wohl weil wir keine tollen Bilder von wilden Strassenschlachten mit der Polizei liefern können.
Wir hören, dass der russischen Zivilgesellschaft das Hirn gewaschen wird. Wir sehen Bilder kriegswilliger Männer, die im Dienst an der Front jede Menge Geld verdienen. Du sagst, die feministische Bewegung sei stark gewachsen. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich glaube, in jedem bewaffneten Konflikt gibt es Leute, die mit Krieg Profit machen oder dem aggressiven toxisch männlichem Setting angehören, dem es einfach gefällt, andere umzubringen. Meiner Meinung nach hat das nichts mit einem Land, einer bestimmten Nationalität zu tun. Als die Mobilisierung losging, waren in den Grossstädten die Strassen wie leergefegt. Auch rechte Parteigänger, dezidierte Kriegsbefürworter oder Putin-Anhänger wollten nicht in den Krieg. Ich war da schon nicht mehr in Russland, aber alle meine Freund·innen haben berichtet, dass die Männer sich versteckt haben, aus gutem Grund. Ab 2022 sind mehr als zwei Millionen Wehrfähige ins Ausland gegangen und nie mehr zurückgekommen. Ganz unabhängig von ihrer politischen Überzeugung wollten sie nicht einrücken. Meiner Meinung nach wollen die meisten Russen nicht kämpfen. Unser feministisches Kollektiv gegen den Krieg ist mit der Vollinvasion entstanden. Gruppen aus den unterschiedlichsten Regionen Russlands sind zusammengekommen; wir haben uns an all den beschriebenen Aktionen beteiligt; Mütter und Ehefrauen von Soldaten, die an die Front gezwungen wurden, schlossen sich zusammen; Angehörige, die trotz massiver Einschüchterung der Regierung ihre Söhne und Männer aus der Armee herausgeholt haben.
Für uns ist es aber genauso wichtig hervorzuheben, dass es neben dem militärischen Konflikt auch um Gendergerechtigkeit geht. Im Krieg werden zuerst die Frauen zum Schweigen gebracht und geschlechtsspezifische Gewalt nimmt zu. In Russland stieg laut Statistik mit dem Ausbruch des Krieges die Gewalt gegen Frauen massiv an. In Krisensituationen, in einer landesweiten Stimmung, in der Gewalt gerechtfertigt und toleriert ist, bekommen das die Frauen zuerst zu spüren. Dieser Effekt ist wissenschaftlich nachgewiesen. Deshalb erklären wir auch, dass es nicht nur um die Auswirkungen auf die Ukraine geht, sondern auch um unsere Gesellschaft, um die Sicherheit von Frauen und Kindern.
Wir sprechen viel darüber, was es bedeutet, wenn die russische Regierung Straftäter vor die Wahl stellt, ihre Haft gegen den Dienst an der Front einzutauschen. Es sind Leute, die wegen Mord, Vergewaltigung oder anderen schweren Delikten zu sechs bis zehn Jahren verurteilt wurden. Sie unterschreiben einen Vertrag und wenn sie das Glück haben, ein paar Monate an der Front zu überleben, kommen sie als «freie» Personen zurück, ihr Strafregister ist gelöscht. Es gab mehrere Fälle, wo diese Kriminellen rückfällig geworden sind, wieder gemordet, vergewaltigt haben. Und dann gehen sie wieder für eine Zeit zum Heer und das ganze wiederholt sich. Das ist ein höllischer Kreislauf und extrem gefährlich für unsere Gesellschaft.
Russland ist ein riesiges Land, wie organisiert ihr die überregionale, bis in die Peripherie reichende Zusammenarbeit?
Obwohl Russland eine enorme geographische Ausdehnung und 140 Millionen Einwohner·innen hat, gab es überall Proteste gegen den Krieg, vom fernen Osten bis in den Süden und hohen Norden. Es ging weit über die Metropolen von Moskau und St. Petersburg hinaus. Wir haben beobachtet, dass in den Teilrepubliken mit ethnischen Minderheiten und Indigenen der Widerstand besonders heftig war. Diese Menschen wurden immer wieder brutal kolonisiert; erst vom russischen Imperium, dann nochmals zu Zeiten der Sowjetunion. Sie haben Rassismus und Unterdrückung erfahren und das hat sich bei der Mobilisierung wieder gezeigt. Denn hier wurden viel mehr Soldaten eingezogen als im «weissen» Moskau oder St. Petersburg. Die Regierung ging davon aus, dass diese «weissen Moskauer» mehr Ressourcen haben, sich zu entziehen; um die anderen kümmert sich sowieso niemand. Die russische Bevölkerung lebt nicht nur in Grossstädten, sondern besteht aus vielen indigenen Völkern und unterschiedlichen ethnischen Minderheiten, die zusammengenommen sehr zahlreich sind und einen grossen Teil des Widerstands gegen das Putin-Regime stemmen. Trotz aller Bedrohungen protestierten sie hartnäckig auch noch nach der Vollinvasion.
Russland hat in den letzten Jahren Kriege an mehreren Fronten geführt. Sind die Leute nicht müde von all dem?
Alle sind müde, Russ·innen und Ukrainer·innen, denn der Krieg tobt seit drei Jahren intensiv. Der Krieg hat schon 2014 begonnen. Es ist eine lange traumatische Erfahrung, ein Ausweg ist nicht in Sicht. Wir von der feministischen Anti- Kriegsbewegung sehen den kommenden Verhandlungen für einen Waffenstillstand sehr besorgt entgegen, da sind wir uns mit unseren ukrainischen Kamerad·innen völlig einig und sagen das der Welt ganz klar: Waffenstillstand bedeutet nicht Frieden. Solange das Putin-Regime existiert, wird es den nicht geben. Natürlich wollen wir, dass die Waffen schweigen, aber selbst wenn das eintritt, gibt es absolut keinen Grund zur Entspannung. Es kommt sehr darauf an, unter welchen Bedingungen verhandelt wird. Wenn es diejenigen von Putin sind, wird es fürchterlich. Nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa und die Welt.
Und was bedeutet das für die Menschen in den derzeit russisch besetzten Gebieten?
Bei der Besetzung der Krim hat das Regime alle Aktivitäten von Menschenrechts-, Demokratie-, Umwelt- und anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen völlig ausgelöscht, da ist absolut nichts mehr möglich, alles erstickt in der eisernen Faust der Regierung. Die Bewohner·innen selbst werden von den Besatzern als Bedrohung gesehen. Diese wissen ganz genau, dass ein grosser Teil der Leute nicht kooperieren will. Das Erste, was Putin nach der Besatzung gemacht hat, war jegliche Aktivität in der Region zu blockieren und die Bewohner·innen massiv zu unterdrücken. Viele Aktivist·innen landeten im Gefängnis. Von der grossen Gruppe der indigenen Krimtatar·innen, die sich besonders gegen die Besatzung wehrten, wurden viele eingesperrt und gefoltert. Flucht oder Gefängnis, das erwartet Tausende von Menschen in den besetzten Gebieten. Diese Leute darf man nicht vergessen!
Wie kannst du von hier aus in Kontakt mit den Leuten in Russland bleiben? Unterstützen die Russ·innen im Exil den Widerstand?
Die russische Zivilgesellschaft, untergetauchte Oppositionelle, Leute, die flüchten mussten und nicht öffentlich auftreten können, oder die, so wie ich, im Ausland leben und öffentlich auftreten können: Wir sind über die Grenzen täglich in Kontakt und arbeiten zusammen. Natürlich nutzen wir Internet, machen Zoom-Konferenzen, haben unsere geschützten Chats und manchmal treffen wir uns auch in Drittländern oder schaffen es, uns geheim zu treffen. Hier in einem freieren Umfeld nutzen wir die Möglichkeit darüber aufzuklären, was in Russland tatsächlich läuft, und unterstützen unsere Kamerad·innen, die noch dort leben. Es war von Beginn an ein Teil der Propagandamaschine, den Zwist zwischen den Leuten im politischen Exil und denen zu Hause zu schüren. Das wird weiter versucht, aber zurzeit arbeiten wir sehr gut zusammen.
Du sagst, politische Kämpfe hängen zusammen, z. B. die Frauen- und die Klimabewegung. Auch in Österreich wird es schwieriger. Was sollte die österreichische Bevölkerung verstehen?
Putins Regime manipuliert Österreich in grossem Ausmass. Ich war schockiert, als ich erfahren habe, wie der Kreml durch die FPÖ und rechte Politiker·innen über Jahre seinen Einfluss ausgebaut hat, ganz abgesehen vom Gas-Deal. Noch erschreckender finde ich, dass die meisten Österreicher·innen das überhaupt nicht realisieren. Österreich, ein Land mitten in Europa, ist für Putin strategisch ungeheuer wichtig. Der Balkan, Tschechien, die Slowakei und Ungarn bilden schon einen prorussischen Block. Überall hatte Putin die Finger im Spiel, um rechts-nationalistischen Regierungen zum Durchbruch zu verhelfen. Österreich wäre ihm eine willkommene Ausdehnung seines Einflussbereichs gegen das übrige Westeuropa. Genau das ist sein geopolitisches Ziel und, wie wir sehen, ist er durchaus erfolgreich. Es ist bekannt, dass prorussische Agent·innen die Strukturen der österreichischen Regierung infiltriert haben. Österreich tritt zwar immer als neutraler Staat auf, Politiker·innen rechter Parteien haben aber persönliche Kontakte in den Kreml. Auch finanzielle Verstrickungen bestehen weiter, wenn auch etwas verdeckter. Das alles ist sehr besorgniserregend.
All das sollte den Österreicher·innen zu denken geben. Der russische Einfluss kann sich sehr ungut auswirken, z.B. wenn die FPÖ, diese Neonazis, an die Regierung kommt. Es gibt hier viele Mythen über Russland. Wenn ich mit Menschen spreche, nicht nur mit Konservativen, höre ich oft: «Russland ist nicht so übel, Putin nicht so schlecht.» Die Leute haben keine Ahnung: weder von den politischen Gefangenen und der Folter noch vom Widerstand gegen die Regierung und dem Aktivismus. Wir müssen jetzt mit allen Mitteln gegen diesen Einfluss ankämpfen, solange das noch möglich ist. Es kann sich sehr schnell ändern.
Das Interview führte Gabi Peissl, EBF Österreich
*Siehe Archipel 350, September 2025, «Polizeiübergriff auf die NS-Gedenkstätte Peršmanhof»