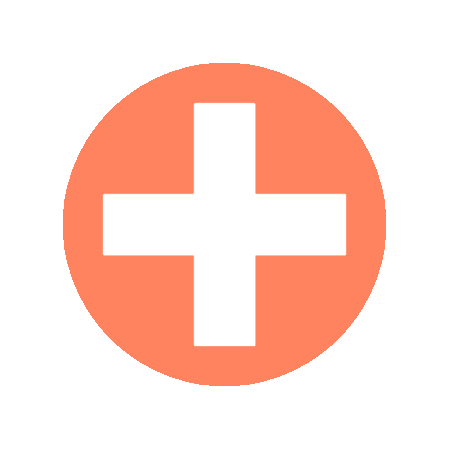Am 18. Juni veranstalteten wir in Bern eine Konferenz unter dem Titel «Wiederaufbau in der Ukraine – die Zivilgesellschaft als treibende Kraft». Es ging darum, die Schweizer Öffentlichkeit für den Wiederaufbau in der Ukraine zu sensibilisieren und gleichzeitig darauf zu drängen, dass das fünf milliardenschwere Schweizer Hilfsprogramm für die nächsten 11 Jahre auch zivilgesellschaftlichen Initiativen zugutekommt.
Rund 80 Menschen fanden sich im Kirchenzentrum CAP in Bern zu diesem Anlass ein. Einerseits waren Gäste aus der Ukraine angereist und andererseits nahmen Vertreterinnen von Schweizer Initiativen teil, die in der Ukraine tätig sind. Die Genossenschaftsbewegung Longo maï mit Sitz in Basel, die seit über 30 Jahren in der Region Transkarpatien engagiert ist, war als Mitorganisatorin präsent.
Die ukrainische Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwijtschuk, Vorsitzende des «Centre for Civil Liberties» (CLL) und Friedensnobelpreisträgerin 2022, musste leider im letzten Moment ihre Teilnahme absagen; sie schickte uns aber eine Videobotschaft, die wir zur Einführung in die Konferenz abspielten und gerne hier im Wortlaut wiedergeben. Ebenso möchten wir unseren Leserinnen und Lesern im Folgenden noch andere Redebeiträge in Auszügen näherbringen.
«Wir müssen jetzt handeln!»
Oleksandra Matwijtschuk: «Ich bin Menschenrechtsanwältin und es ist mir eine Ehre, vor diesem Publikum sprechen zu dürfen. Ich dokumentiere Kriegsverbrechen in diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Während dieser Krieg Menschen zu Zahlen macht, geben wir ihnen buchstäblich ihre Namen zurück, denn Menschen sind keine Zahlen, und das Leben jedes Einzelnen zählt. Dieser Krieg hat nicht nur eine militärische, sondern auch eine wirtschaftliche Dimension. Putin versucht, den Widerstand der Bevölkerung zu brechen und das Land zu besetzen, indem er Wohnhäuser, Fabriken, Strassen, Kirchen, Schulen, Museen und Krankenhäuser gezielt zerstört. Deshalb können wir es uns nicht leisten, den Wiederaufbau auf die Nachkriegszeit zu verschieben. Wir müssen jetzt handeln. Und ich möchte heute zwei wichtige Botschaften vermitteln: Wenn wir über Wiederaufbau sprechen, denken wir zunächst an die Wiederherstellung von Wohngebäuden, Strassen und ziviler Infrastruktur. Das ist sicher wichtig und unverzichtbar, aber die Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind, müssen die Priorität bilden. Es sollte ein Programm für Überlebende von Verbrechen geben, mit medizinischer und psychologischer Hilfe für die Menschen. Es sollte Hilfsprogramme für Binnenvertriebene und für Menschen geben, die in zerstörte Gemeinden zurückkehren. Nötig sind Entwicklungsprojekte für die lokalen Gemeinschaften und Unterstützung für lokale Unternehmen, da diese durch die russische Aggression ihre wichtigsten Vermögenswerte und Einrichtungen verloren haben. Auch Umweltprobleme müssen angegangen werden.
Und zweitens: Damit sich der Wiederaufbau nicht nur auf gross angelegte Bauvorhaben beschränkt, müssen wir die lokalen Behörden und die Zivilgesellschaft in alle Phasen dieses Prozesses einbeziehen, also in die Planung, Umsetzung und Überwachung. Wir müssen ein Dreieck bilden, in dem die internationalen Partner mit den lokalen Behörden und der Zivilgesellschaft im weitesten Sinne zusammenarbeiten, mit den lokalen Unternehmen, den zivilgesellschaftlichen Organisationen, Umweltgruppen und so weiter. Nur gemeinsam werden wir Erfolg haben.»
Zusammen die Dinge verändern
Nataliya Kabatsiy leitet seit 25 Jahren die nichtstaatliche Organisation «Komitee für medizinische Hilfe in Transkarpatien» (CAMZ) mit inzwischen17 Mitarbeiter:innen. Diese arbeitet in verschiedenen Bereichen, aber die wichtigsten Themen, die sie vor dem Krieg beschäftigten, waren Menschen mit Behinderungen, die Menschenrechte im Allgemeinen und die Migration. Sie arbeitet lokal in Transkarpatien aber auch überregional in einem breiten Netzwerk. Sie erklärt eingangs in ihrem Redebeitrag: «Wir haben staatliche Finanzierung in der Ukraine immer abgelehnt, um unabhängig zu bleiben, weil hier die Politik einerseits Einfluss ausüben will und andererseits sehr wechselhaft ist. Wir wollten keine politische Etikette, so waren wir natürlich auf internationale Fonds angewiesen.»
Das CAMZ hat inzwischen grosse Erfahrung sowohl mit verschiedenen privaten Organisationen aus dem Ausland als auch mit staatlichen Institutionen in Deutschland, Frankreich oder mit der Europäischen Union: «Wir arbeiten gerne mit kleineren Institutionen zusammen, weil wir auf diese Art Projekte realisieren können, die direkt auf die Menschen zugeschnitten sind. Mit den grossen Institutionen gibt es meistens grosse politische Linien im Hintergrund und sie agieren von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Als Geldgeber wollen sie bestimmen, wo es lang geht. Sie meinen, es besser zu wissen als diejenigen, die vor Ort sind. Die Ortskundigen sind aber die einzigen, die wirklich wissen, was es braucht. Das ist der Unterschied, wenn man mit verschiedenen Donatoren arbeitet.»
Das CAMZ kooperiert seit fast 20 Jahren mit privaten Institutionen in der Schweiz, u.a. mit dem Europäischen Bürger·innen Forum und Longo maï. Ausserdem ist Nataliya Mitbegründerin des «Netzwerks Schweiz-Transkarpatien/ Ukraine» (NeSTU), das verschiedene soziale und kulturelle Projekte mitaufgebaut hat. Mit dem Verein Parasolka in der Schweiz konnte das CAMZ vor 15 Jahren ein Pilotprojekt mit behinderten Menschen in Transkarpatien starten, das zum positiven Vorbild für die ganze Ukraine wurde. Dann kommt Nataliya auf den Krieg und auf die Rolle der Zivilgesellschaft zu sprechen: «Als der Krieg kam, waren wir nicht vorbereitet. Aber wir waren doch irgendwie bereit, weil wir die ukrainische Zivilgesellschaft sind, die immer anders leben wollte. Wir wollten nicht unter Diktatoren leben; die haben wir nach Russland geschickt. Und wir haben die Maidan-Revolution gemacht, und zwar nicht für nichts, sondern um unsere Situation zu verändern. Es ist die Zivilgesellschaft, die 2014 nach der Annexion der Krim die ersten Geflüchteten von der Krim, aus Luhansk und dem Donbass aufgenommen hat. Es ist die Zivilgesellschaft, die nie aufgehört hat, den Staat zu Reformen zu drängen. (…) Die Oberen versuchen oft, krumme Sachen zu machen, aber sie horchen immer, ob unten etwas passiert oder nicht. Sie müssen auf die Zivilgesellschaft hören, weil sie wissen, dass es jederzeit wieder zur Revolte kommen kann[1]. Denn zusammen können wir die Dinge verändern. Und diese Haltung hat uns in den ersten zwei Monaten geholfen, als der grosse Krieg begonnen hatte.
Es gab zuerst keine grosse internationale Hilfe, weil niemand dachte, dass wir uns halten könnten. Es gab gegenseitige Hilfe unter den Menschen. (…) Das hat uns ermöglicht zu handeln. Wenn man über den Wiederaufbau spricht, sollte man immer im Kopf haben, dass dieses Land ein bisschen anders ist und dass die Zivilgesellschaft ihre Rolle im Wiederaufbau zu spielen hat. Man sagt, dass man die Ukraine nach dem Krieg wieder aufbauen kann, aber es geht auch um das hier und jetzt. Nach jedem Bombardement erhalte ich Telefonanrufe von Menschen, die fragen, ob wir sie aufnehmen können. Denn wir haben drei Notaufnahme-Häuser in Transkarpatien. Die Anzahl der Geflüchteten steigt stetig. Jeden Tag werden neue Städte und Dörfer zerstört. Es braucht Lösungen, die wir schon heute in Angriff nehmen. (…)
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir arbeiten seit 20 Jahren mit einem Waisenhaus, welches Kinder mit verschiedenen Behinderungen beherbergt. Der Direktor erhält sofort Anrufe, wenn irgendwo in der Ukraine ein Waisenhaus schliesst und es Kinder gibt, die wegmüssen, weil der Ort von einer Bombe getroffen wurde. Sie werden dann nach Transkarpatien evakuiert. Wir selber haben nicht genug Platz. Sie werden von uns provisorisch aufgenommen. Doch man muss sofort überlegen, wo man sie, in welcher Institution, langfristig unterbringen kann.
In unseren Aufnahmehäusern für interne Geflüchtete gibt es viele ältere Menschen, die nie wieder in ihr Dorf zurückkehren können. Also muss man überlegen, wie man diesen alten Menschen helfen kann, damit sie in Würde leben können. Wenn ich höre, dass viele finanzielle Mittel des Schweizer Hilfsprogramms für die Ukraine in Schweizer Unternehmen fliessen[2], verstehe ich das einerseits, denn jedes Land will seine eigene Wirtschaft unterstützen, aber andererseits muss ich sagen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer viele Ideen haben; sie sind sehr innovativ, und es wäre beispielsweise möglich, sie mit Mikrokrediten zu unterstützen, damit sie ihre Wirtschaft selbst wieder aufbauen und so das Land stabilisieren können.»
Was ist die Perspektive?
Francesca Chukwunyere ist Abgeordnete im Stadtrat von Bern und die ehemalige Leiterin der «Temporären Unterkunft Viererfeld» (TUV), die hauptsächlich für ukrainische Geflüchtete eingerichtet worden war. Ihr fiel auf, dass die Zusammensetzung der Ankommenden anders war als bei vorherigen Flüchtlingsgruppen: hauptsächlich Frauen und ältere bis alte Menschen, aber auch viele Kinder. Ein Grossteil der Beherbergten im Viererfeld waren Roma, die aus dem Westen der Ukraine, also aus Transkarpatien, kamen. Als das Schweizer Parlament im Herbst 2024 den S-Status für Geflüchtete aus dem Westen der Ukraine abschaffen wollte, beschloss Francesca Chukwunyere vor Ort zu gehen, um die Situation zu erkunden. So lernte sie die oben erwähnten Projekte kennen, die alle von privater Natur sind. Von ukrainischer staatlicher Seite her besuchte sie das einzige Altersheim, das existiert, und 200 Plätze hat – bei einer Einwohnerzahl in Transkarpatien von inzwischen rund 1,2 Millionen Menschen. Ein Viertel der Bewohner·innen in diesem Heim sind Binnenflüchtlinge: «Meine Sorge als Leiterin des Zentrums für Geflüchtete in Bern war immer: Was passiert mit den Leuten, wenn sie zurückmüssen oder wieder zurückwollen? Gerade die älteren Leute wollen kaum hierbleiben. Aber was ist die Perspektive, wenn sie zurückgehen? Und was passiert mit den Roma, wenn deren S-Status nicht verlängert wird oder sie gar nicht mehr hierherkommen können?» Francesca Chukwunyere besuchte auch eine Romasiedlung in Mukatschevo[3]. In diesem eigentlichen «Roma-Ghetto» lebten vor dem Krieg rund 15'000 Menschen. Sie werden diskriminiert und durch den Krieg noch mehr an den Rand gedrängt.
Bessere Vernetzung
Als Fazit der Konferenz waren sich alle Rednerinnen und Redner einig, dass die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau spielen muss. Der offiziellen Schweiz wird empfohlen, die 5 Milliarden Franken für die Ukraine nicht nur in Schweizer Unternehmen und in Grossprojekte zu investieren[4], sondern vor allem die zivilgesellschaftlichen Initiativen zu fördern. Auf Unverständnis stösst, dass die Region Transkarpatien gar nicht berücksichtigt wird. Zwar sind hier die materiellen Zerstörungen gering, aber die Region ist als Fluchtpunkt für Zehntausende und als Ort der Resilienz enorm wichtig und auf Unterstützung angewiesen. Die Konferenz war jedenfalls ein wichtiger Schritt für eine bessere Vernetzung zwischen den anwesenden Initiativen und ein Plädoyer für einen Wiederaufbau «von unten».
Michael Rössler, EBF Schweiz
Ein aktueller Beweis dafür: Die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden beschnitten hätte, führte Ende Juli zu landesweiten Strassen-Protesten mit Tausenden von vor allem jungen Menschen, so dass Präsident Selenskyj zurückrudern musste.
Von 1,5 Milliarden Franken an Wiederaufbauhilfen bis 2028 fliessen 500 Millionen an Schweizer Wirtschaftsunternehmen, die in oder für die Ukraine tätig sind.
Siehe Archipel Nr.344: J. Kräftner: «Roma in Transkarpatien»
Siehe Archipel Nr. 347: M. Rössler: «Wer hilft wem?» Der Bundesrat hat 1,5 Milliarden Franken an Wiederaufbauhilfen bis 2028 vorgesehen. Davon sollen aus dem Budget der Entwicklungszusammenarbeit allein 500 Millionen über die Schweizer Wirtschaft laufen.