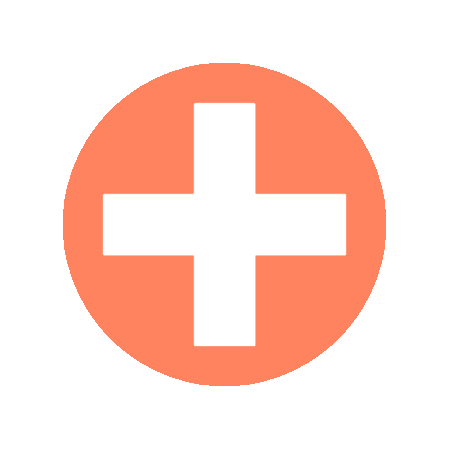Nach der Euphorie über den Sturz des Diktators Baschar al-Assad befindet sich die autonome Region im Nordosten Syriens im Ungewissen. Ihre Autonomie und ihr politisches System sind durch den Regimewechsel und die anhaltenden Kämpfe gefährdet.
In Syrien weht ein Wind der Freiheit nach fünf Jahrzehnten Diktatur unter dem Assad-Regime – Vater und später Sohn. Dreizehn Jahre Kämpfe, 6 Millionen ins Ausland Geflüchtete und 7 Millionen Binnenvertriebene (bei einer Bevölkerung von 21 Millionen) waren der kolossale Preis dafür. Seit dem Sturz von Baschar al-Assad am 8. Dezember 2024 herrscht jedoch Jubel: Familien, die durch den Krieg getrennt waren, werden wieder zusammengeführt, die Gefangenen befreit und Vermisste gefunden. Für andere überwiegt die Not, wenn es darum geht, die Massengräber zu öffnen und eine erschreckende Bilanz der Vernichtungspolitik des Regimes gegen seine Gegner·innen zu ziehen.
In der autonomen Region im Nordosten Syriens, in der 4 Millionen Menschen und der Grossteil der kurdischen Bevölkerung des Landes leben, ist die Euphorie über den Sturz Assads von Angst überschattet. «Seit mehr als 25 Tagen fliegen jeden Tag Hunderte von Granaten durch den Himmel über unserem Dorf», erzählt uns Abu Dalshir[1] am Telefon mit vor Angst erstickter Stimme.
Sein Dorf steht unter Beschuss von bewaffneten Gruppierungen, die von der Türkei[2] unterstützt werden und den Sturz Assads nutzen, um in den Osten Syriens vorzudringen. Für Abu Dalshir gibt es keinen Zweifel: «Diese Angriffe zielen darauf ab, die Kurdinnen und Kurden aus ihrem Gebiet zu vertreiben.» Seine Angst wird in der autonomen Region im Nordosten Syriens – besser bekannt als Rojava[3] –, die sich von Syriens Grenzen zum Irak und zur Türkei bis zu den Ufern des Euphrat erstreckt, weitgehend geteilt. Die Menschen in Rojava befürchten, dass das seit zehn Jahren bestehende demokratische System dem Sturz von Baschar al-Assad zum Opfer fallen könnte.
Anerkennung aller Gemeinschaften
Während des Bürgerkriegs nutzte die Region, die von einem Mosaik aus arabischen, kurdischen, syrischen, armenischen und yezidischen Gemeinschaften bewohnt wird, die militärische Schwächung des Assad-Regimes, um sich eine zunehmende Autonomie mit einer ganz besonderen demokratischen Regierungsform zu erkämpfen. Doch dieses Experiment der Selbstverwaltung scheint mehr denn je auf Bewährung zu sein.
Seit 2013 wird der Nordosten Syriens von der «Autonomen Administration Nord- und Ostsyrien» nach einem originellen Modell der dezentralisierten Demokratie, dem demokratischen Konföderalismus, regiert. Unter diesem Modell, das darauf angelegt ist, jeder Gemeinschaft ein Höchstmass an Autonomie zu garantieren, ist das Gebiet in «Gemeinden» aufgeteilt, die sich lokal selbst verwalten. Die Schlüsselpositionen werden von einem männlich-weiblichen Zweiergespann besetzt, wodurch eine repräsentative Parität gewährleistet wird. Unter der Ägide der Autonomieverwaltung hat der Nordosten Syriens sein eigenes Rechtssystem und seinen eigenen Lehrplan entwickelt. Er wurde zur einzigen Region des Landes, in der Kurdisch und Neuaramäisch neben Arabisch als offizielle Sprachen anerkannt wurden – eine echte Revolution in einem Land, in dem 120.000 Kurd·innen 1962 vom syrischen Staat die Staatsbürgerschaft entzogen worden war. Dieses demokratische System wurde von Abdullah Öcalan entwickelt, einem der inhaftierten Führer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – einer in der Türkei entstandenen kurdischen Guerilla, die in ihren Anfängen marxistisch-leninistisch war. Die PKK übte während des Bürgerkriegs – von 2011 bis heute – einen erheblichen militärischen Einfluss im Nordosten Syriens aus und trug zur Schaffung der Autonomieverwaltung bei.
Druck von Aussen
Dies erklärt Ankaras feindselige Haltung gegenüber dem syrischen Autonomiegebiet: Nach Ansicht der Türkei stellt dieses eine rückwärtige Basis der PKK und eine Bedrohung für ihre Sicherheit dar. Für das Erdogan-Regime ist dieses Gebiet ein Experimentierfeld der PKK, wo diese daran sei, ihre politischen Ideen umzusetzen, was dazu führen würde, dass auch bei den Kurd·innen in der Türkei neue Autonomiegelüste aufkämen. Ankara bombardiert regelmässig die Stellungen der «Syrischen Demokratischen Kräfte», des bewaffneten Arms der Autonomieverwaltung, sowie deren Territorium. Heute ist die Autonomie des syrischen Nordostens mehr denn je bedroht – zunächst in militärischer Hinsicht: Einige der bewaffneten Fraktionen, die Assad während des gesamten Krieges bekämpft haben, werden von Ankara finanziell und militärisch unterstützt. Diese Gruppierungen nutzen nun die Niederlage des Regimes, um in Richtung Nordosten vorzurücken. Anfang Januar dieses Jahres belagerten sie Kobane, eine Märtyrerstadt, die 2015 in letzter Minute von kurdischen Kämpfer·innen vor dem Islamischen Staat (IS) gerettet worden war.
Auf politischer Ebene steht die autonome Region unter starkem Druck, sich wieder in ein vereintes Syrien einzugliedern. Ahmad al-Sharaa, der Anführer der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS)[4], der seit dem Sturz Assads neuer Herrscher über Damaskus ist, möchte die militärischen Fraktionen des Landes so schnell wie möglich wieder vereinen. «Diese neue Regierung ist legitimer als das Assad-Regime», erklärt Thomas Schmidinger, Politologe, Professor an der Universität Wien und Autor mehrerer Bücher über die kurdische Geschichte: Die Autonome Administration sieht sich daher einem grösseren Druck ausgesetzt, sich wieder vollständig in den syrischen Staat zu integrieren.» Die Geschichte der Beziehungen zwischen der Autonomieverwaltung und der HTS sowie ihren Verbündeten ist seit Beginn des Bürgerkriegs jedoch turbulent. Viele Revolutionäre, die gegen das Assad-Regime gekämpft haben, werfen den Kurden vor, während des Krieges mit ihm zusammengearbeitet zu haben: Ab 2013 überliess ihnen Assad zahlreiche Stellungen im Nordosten, um seine Kräfte gegen die Rebellen im Zentrum des Landes zu konzentrieren. Mehrfach musste sich die Autonomieverwaltung anschliessend dem syrischen Regime oder seinen Verbündeten annähern, um ihr Überleben unter dem Druck Ankaras zu sichern. Die Kommunikation der Autonomieverwaltung mit der HTS hat sich seit dem Sturz des Regimes zwar etwas verbessert – sehr zum Leidwesen der Türkei und ihrer militärischen Helfer –, aber die beiden verfolgen nicht die gleichen politischen Ziele.
Interne Revolten
Schliesslich ist die Autonomieverwaltung mit dem Risiko interner Revolten konfrontiert, da ihre Bilanz nach einem Jahrzehnt an der Macht mehr als gemischt ist. Zwar haben die Vertretung von Frauen und die Rechte von Minderheiten dank des demokratischen Konföderalismus zweifellos Fortschritte gemacht. Aber hinter den «offiziellen politischen Strukturen der Autonomieverwaltung, die dem föderalistischen Modell entsprechend gut folgen, ist dies in den anderen Machtzentren – Wirtschaft oder Militär – nicht unbedingt der Fall», erklärt Thomas Schmidinger. Mehr als die Autonomieregierung entscheiden die Kader der herrschenden Partei und die Führung der «Syrischen Demokratischen Kräfte» über Schlüsselthemen. Letztere haben während des Krieges Übergriffe gegen Oppositionelle, Journalist·innen und Zivilist·innen begangen (z.B. Beschlagnahmung ihres Eigentums). In den arabischen Gebieten der Provinz Raqqa oder Deir-e-Zor, wo einige Stämme wiederholt gegen die Autonomieverwaltung rebelliert haben, hat sich angesichts dieser Missstände ein spürbarer Groll entwickelt.
Die HTS-Gruppe plant nun, einen «nationalen Dialog» einzuleiten, um eine neue Verfassung zu entwerfen. «Die Autonomieverwaltung möchte daran teilnehmen», erklärt Leila Karaman, Ko-Vorsitzende des höchsten politischen Gremiums der Autonomen Administration: «Wir sind für den Dialog zwischen den Syrerinnen und Syrern, mit den Nachbarländern, mit allen politischen Parteien und Kräften, und mit der Übergangsregierung in Damaskus.»
Die Kurd·innen und ihre Verbündeten wollen dort für ein föderalistisches Modell für das Land eintreten: «Wir haben unter dem Baath-Regime* Erfahrungen mit einem totalitären Zentralstaat gemacht. Über 60 Jahre lang wurden nicht-arabische Minderheiten ausgegrenzt und marginalisiert», argumentiert Sanharib Barsoum, Ko-Vorsitzender der Syrischen Einheitspartei, die Mitglied der Autonomieverwaltung ist. Ein Bundesstaat wäre am besten geeignet, um die Rechte aller Gemeinschaften in allen Regionen zu gewährleisten.»
Für viele Bewohner·innen des Nordostens kommt es nicht in Frage, die so hart erkämpfte Autonomie aufzugeben. Auch wenn die Autonomieverwaltung, wie Thomas Schmidinger erinnert, nie die Unabhängigkeit angestrebt hat: «Sie haben sich immer als Teil Syriens betrachtet.»
Die Kurd·innen und ihre Verbündeten befürchten jedoch, dass sie unter die Kontrolle feindlicher Gruppen geraten könnten, wie etwa von Ankara unterstützte Gruppierungen, welche die kurdischsprachigen Minderheiten, die während des Krieges in den von ihnen kontrollierten Gebieten lebten, brutal misshandelt und ins Exil getrieben haben. «Unser Volk hat unter dem IS einen Völkermord erlitten und wir haben Angst, dass sich dieser unter einer Organisation, die zwar nicht denselben Namen trägt, aber die gleiche Ideologie hat, wiederholen könnte», sagt Sanharib Barsoum.
Unmittelbar hängt das Überleben der autonomen Region von den Kräfteverhältnissen vor Ort ab: der Fähigkeit der «Syrischen Demokratischen Kräfte», dem Vormarsch ihrer Feinde zu widerstehen, der Fähigkeit der autonomen Regierung, ihr Gebiet zu kontrollieren, und der Bereitschaft des Westens, ihre kurdischen Verbündeten zu unterstützen, die im Kampf gegen den IS eine Schlüsselrolle gespielt haben. In diesem Punkt versuchte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot bei seinem Besuch in Syrien am 3. Dezember 2024 zu beruhigen, indem er für eine «politische Lösung» mit den «Verbündeten Frankreichs, dem kurdischen Volk» plädierte.
Leila Karaman fordert ihrerseits mehr westlichen Druck auf die Türkei, damit die Kämpfe aufhören. In Qamischli, der Hauptstadt der autonomen Region, hofft man, einen Kompromiss zu finden: «Wir haben versucht, mit Baschar al-Assad zu verhandeln, ohne Ergebnisse zu erzielen, und wir werden auch mit dem neuen Regime verhandeln», sagt Sanharib Barsoum. «Alles, was die Zukunft Syriens betrifft, muss von allen Syrerinnen und Syrern entschieden werden und nicht nur von denen, die heute in Damaskus regieren.»
Lyse Mauvais und Solin Muhammed Amin, Journalistinnen, Qamishli (Syrien)*
- Dieser Artikel erschien auf Französisch am 14. Jänner dieses Jahres in «Reporterre», einer unabhängigen und werbefreien, frei zugänglichen französischen Internetzeitung für ökologische Anliegen (www.reporterre.net). Die Autorin hat ihn uns freundlicherweise auch für den Archipel zu Verfügung gestellt.
Aus Angst, dass sein Dorf irgendwann unter die Kontrolle einer pro-türkischen Fraktion geraten könnte, bat uns Abu Dalshir, ein Pseudonym zu verwenden.
Diese Konstellation von oppositionellen Gruppierungen, die von der Türkei unterstützt und teilweise bewaffnet werden und sich gegen Baschar Al-Assad richteten und die Kurden angreifen, wird unter dem Namen «Syrische Nationale Armee» (SNA) zusammengefasst.
Der Name Rojava bezieht sich auf das historische syrische Kurdistan. Zu Beginn des Krieges bezog sich die Autonomie vor allem auf den äussersten Norden des Landes, der überwiegend von Kurden bewohnt wird, daher der Name. Als sich die autonome Region nach Süden und Westen ausdehnte, versuchten ihre Führer, sich von diesem Etikett zu lösen, das von einigen als zu kurdisch angesehen wurde.
Hayat Tahrir al-Sham (Komitee zur Befreiung der Levante bzw. auch Organisation zur Befreiung Syriens), eine dschihadistische Nachfolgeorganisation der Jabhat al-Nosra-Front, brach 2017 formell mit Al-Qaida. Vor der Eroberung von Damaskus kontrollierte die Bewegung unter der Führung von Ahmad al-Sharaa (besser bekannt unter seinem Kampfnamen al-Jolani) die Provinz Idleb, die letzte Hochburg der syrischen Opposition im Land, mit etwa 3 Millionen Einwohner·innen (darunter 2 Millionen Vertriebene).