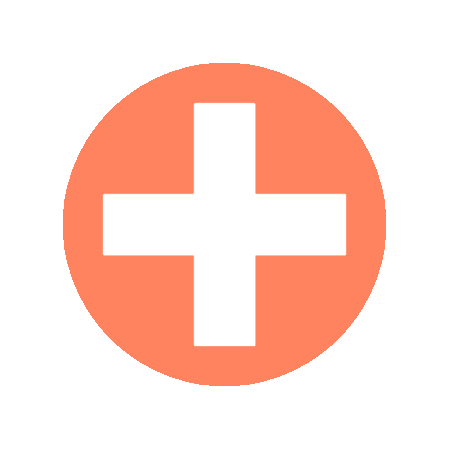Auf Initiative der Familien der Getöteten und Verschwundenen vom 6. Februar 2014 wird alljährlich die «Commémor Action»[1] auf verschiedenen Kontinenten durchgeführt. Hier berichten wir über die Geschichte dieses Tages sowie speziell über die Gedenkaktionen und die Situation der Migrant·innen in Briançon an der französisch-italienischen Grenze.
Am 6. Februar 2014 versuchten mehr als 200 Menschen von der marokkanischen Küste aus, schwimmend in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen. Als sie nur noch wenige Dutzend Meter vom Tarajal-Strand entfernt waren, setzte die spanische Guardia Civil Aufstandsbekämpfungsmittel ein, um sie daran zu hindern. Weder die Guardia Civil noch die anwesenden marokkanischen Soldaten leisteten den Menschen, die vor ihren Augen ertranken, Hilfe. Auf der spanischen Seite wurden 15 Tote geborgen, Dutzende weitere sind verschwunden, die Überlebenden wurden zurückgeschickt und einige kamen auf der marokkanischen Seite ums Leben. Seitdem wird jedes Jahr an diesem Tag auf Initiative der Familien der Getöteten und Verschwundenen eine sogenannte «Commémor Action» durchgeführt. Sie wollen die Erinnerung an ihre Angehörigen wachhalten, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung fordern und dafür kämpfen, dass die Migrationspolitik der reichen Länder aufhört, Tausende von Menschen zu töten.
Seit nunmehr elf Jahren findet jeweils am 6. Februar in vielen Städten Europas, Afrikas und sogar an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine solche Gedenkaktion statt. Im Jahr 2024 (zum zehnten Jahrestag) wurden insgesamt 55 Veranstaltungen in 17 Ländern notiert. Die Schiffbrüche wie am 13. Juni 2023 vor Pylos in Griechenland mit mehr als 600 Toten oder wie in Süditalien, im Ärmelkanal oder vor den Kanarischen Inseln sowie die vielen Vermissten in der Wüste bringen immer mehr Menschen dazu, sich mit diesen Familien zu solidarisieren, und das nicht nur in den Grenzregionen.
Gedenkaktion in Briançon
An der französisch-italienischen Grenze in den Alpen, wo seit 2018 zwölf Menschen gestorben oder verschwunden sind, begingen wir diesen Jahrestag in der Stadt Briançon mit Debatten, Informationsaustausch, Theater- und Konzertabenden und dem Bau einer Gedenkstätte. Das Ganze dauerte zehn Tage, und Hunderte von Menschen mobilisierten sich während unterschiedlichen, sich gegenseitig ergänzenden Zeiten. Dieser Zusammenhalt der verschiedenen solidarischen Akteur·innen hat unsere Entschlossenheit gestärkt, die Region zu einem aufnahmefreundlichen Gebiet zu machen – reich an unterschiedlichen Ansätzen und Handlungsweisen seiner Bewohner·innen. Diese Tage waren auch eine klare Antwort auf die Versuche des rechtsgerichteten Bürgermeisters, uns zu spalten. Denn er würde gerne zwischen den anerkannten Vereinen und den informelleren Komitees, zwischen den «guten humanitären» und den «gefährlichen autonomen», einen Keil treiben.
Derselbe Bürgermeister liess übrigens am Tag nach der Gedenkaktion im Stadtrat über den Kauf eines Allradfahrzeugs abstimmen, um es der Grenzpolizei gratis zur Verfügung zu stellen, so als ob es dieser an Mitteln fehlen würde. Er beschloss also, einen Teil der städtischen Gelder für den «Schutz» der Grenze zu verwenden, obwohl diese gar nicht durch sein Gemeindegebiet verläuft, sondern weiter oben in den Bergen bei Montgenèvre. Andererseits betont er jedes Mal, wenn wir ihn auf die schwierige Situation der neu ankommenden Schutzsuchenden ansprechen, dass die Migrationspolitik und die Notunterbringung ausschliesslich in die Zuständigkeit des Staates fielen und nicht Sache der Gemeinde seien.
Die Gedenkstätte, die in der Nähe der Asfeld-Brücke an der Durance errichtet wurde, wo der letzte Vermisste ertrunken war, wurde von sehr vielen Menschen besucht, mit Blumen geschmückt und verteidigt. Es handelte sich um einen «Cairn»[2], eine kleine Steinpyramide, die normalerweise dazu dient, sich in den Bergen zu orientieren, mit einer integrierten Holzskulptur, welche die Aufschrift «Mémorial aux mort-es des frontières» (Denkmal für die Grenztoten) trug und 12 Gedenktafeln mit den Vornamen, Geburts- und Todesdaten aller vor unserer Haustür verschwundenen Personen beinhaltete. Nach zwei Monaten liess die Stadtverwaltung das Denkmal von den technischen Diensten der Gemeinde zerstören – unter dem Vorwand, dass wir keine Genehmigung beantragt hätten. Was würde man wohl dazu sagen, wenn eine Gruppe, die einer bestimmten Denkrichtung angehört, ein Kriegerdenkmal zerstören würde? Ausserdem sind Bergpfade und Strassenränder übersät mit kleinen Denkmälern, die an die Menschen erinnern, die dort gestorben sind, ohne dass jemand daran denkt, sie zu entfernen. Sind manche Leben wertvoller und verdienen mehr Respekt als andere? Oder war die Inschrift, die an die Verantwortung des Staates für diese Tragödien erinnert, zu verstörend?
Plötzliche Hoffnung
Wir schöpften jedoch auch neue Hoffnung: Der französische Staatsrat und der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hatten in einer Entscheidung vom 4. Februar 2024 nach jahrelangen Verfahren die Einreiseverweigerung an den Binnengrenzen für rechtswidrig erklärt. Wir glaubten, dass dies das Ende der Toten, Verletzten und Traumatisierten in unserem Berggebiet sein würde, welches – zwar in viel kleinerem Massstab – zu einem Friedhof wie das Meer und die Wüste geworden war. Und tatsächlich änderte sich die Vorgehensweise fast neun Monate lang: Die Migrant·innen wurden zwar angehalten oder festgenommen, aber nach Feststellung ihrer Identität, ihres Herkunftslandes und der Abgabe ihrer Fingerabdrücke wieder freigelassen. Dies war ein wesentlicher Fortschritt, obwohl deren Recht auf Beantragung von Asyl immer noch nicht respektiert wurde. Der Zugang zu Dolmetschern war ihnen verwehrt, es kam zu keiner Anhörung, und niemand wurde über seine Rechte informiert. Wir möchten betonen, dass es in diesem Zeitraum viel weniger Verletzte gab, aber nicht mehr Ankünfte als in den Vorjahren. Diese Tatsache widerlegt die berühmte Theorie, dass eine Sogwirkung entstünde, sobald es keine Abschottung mehr gäbe. Und diejenigen, die uns vorwerfen, wir würden die Migrant·innen durch einen solidarischen Empfang dazu verleiten, über Briançon zu gehen, möchten wir daran erinnern, dass es auch in Modane und Ventimiglia viele Durchreisende gibt, wo aber keine entsprechenden Aufnahme-Strukturen wie das hiesige «Refuge solidaire» existieren.
Doch nur eine Atempause
Die Atempause dauerte leider nur wenige Monate. Eine sogenannte «Harmonisierung der Massnahmen» führte nicht etwa dazu, dass an allen anderen Binnengrenzen die Entscheidungen des Staatsrats und des EuGH eingeführt bzw. respektiert wurden, sondern hatte zur Folge, dass die Grenzpolizei in Briançon die Einreiseverweigerungen wieder aufnahm, die an den anderen Grenzübergängen übrigens nie aufgehört hatten. Die Migrant·innen sind erneut gezwungen, über abgelegene und gefährliche Routen zu reisen, nachts und im Schnee, um den Kontrollen der Grenzpolizei zu entgehen. Es sind nicht die Berge an sich, schlechte Wetterbedingungen oder unüberlegte Risikobereitschaft, die sie in Gefahr bringen, sondern das Vorgehen der Grenzpolizist·innen, die von einer immer repressiveren Migrationspolitik gesteuert werden. Heute befürchten wir wieder Unfälle und Todesfälle und haben deshalb die solidarischen Bergtouren («les maraudes») wieder aufgenommen, um in Not geratene Menschen zu retten. In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, dass wir niemanden «durchschleusen». Alle, die ankommen, haben bereits die Balkanroute hinter sich oder die Wüste und das Meer durchquert, wurden auf dem Weg gefoltert oder vergewaltigt, insbesondere in Libyen, haben bereits viele andere Grenzen autonom überschritten und brauchen niemanden, der ihnen hilft, um mit der Kraft und Entschlossenheit weiterzumachen, die sie bis jetzt getragen hat. Wir wenden lediglich die Regeln der Risiko-Minimierung an und versuchen, die Menschen in den Bergen zu finden, bevor sie erfrieren, sich verirren oder von einem Felsen stürzen. Dabei handelt es sich um die elementarste Solidarität in einem Gebiet wie in den Bergen, wie sie praktiziert werden muss. Ähnlich ist es in der Wüste oder auf dem Meer.
Tote an den Grenzen
Wir verwenden den Begriff «Tote an den Grenzen», der aber nicht nur auf die Grenzen zutrifft, denn zu den Menschen, die auf der Reise ihr Leben verloren haben, könnten wir noch die Todesfälle durch Suizid oder mangelnde medizinische Versorgung in den Abschiebegefängnissen oder Lagern sowie alle Opfer von rassistischen und fremdenfeindlichen Verbrechen hinzufügen. Wir sollten auch all jene erwähnen, die ein Kind, einen Bruder, eine Mutter, einen Freund vor ihren Augen verloren haben, manchmal sogar mehrere, und die nun zwar am Leben sind, aber ohne ihre Angehörigen und für immer traumatisiert. Am 6. Februar dieses Jahres versuchen wir, den Cairn wieder aufzubauen. Die Holzskulptur und die Gedenktafeln, die wir bewahren konnten, werden darin eingemauert, und er wird an einem öffentlichen Ort stehen, wo er wieder von Hunderten von Menschen besucht und mit Blumen geschmückt werden kann, egal ob diese auf der Durchreise sind oder speziell dafür kommen. Denn obwohl Menschen hier ihr Leben gelassen haben, ist dieses Gebiet sowohl im Sommer als auch im Winter ein Spielplatz für Tausende von Urlauber·innen, welche die Grenze mehrmals täglich auf Skiern, mit dem Mountainbike oder zu Fuss überqueren, ohne dabei im Geringsten behelligt zu werden. Welch ein Widerspruch!
Der Ski-Ort Montgenèvre, der stolz auf seine grenzüberschreitenden Pisten ist, soll bei den Olympischen Winterspielen 2030 auch Schauplatz von alpinen Wettkämpfen sein. Es bleibt abzuwarten, nach welchen Kriterien die Grenzpolizei während dieser Zeit kontrollieren wird. Auf den Skipisten und Wanderwegen, die für Spaziergänger·innen markiert sind, werden auch Zeichen von den Helfer·innen gesetzt, um den Schutzsuchenden den richtigen Weg ins Tal zu weisen. Ausserdem hinterlassen die Migrant·innen absichtlich Spuren in Form von «verlassenen» Kleidungsstücken, um denjenigen, die nach ihnen kommen, die Richtung zu zeigen. Die Markierungen, die von den Helfer·innen angebracht wurden, werden von wem auch immer systematisch verwischt, aber danach unermüdlich wiederhergestellt. Die Kleidungsstücke, die verloren scheinen, werden unter dem Vorwand der Säuberung der Natur eingesammelt, nicht ohne gegen diese «Ausländer·innen» zu wettern, die nichts respektieren. Diese wenigen Stofffetzen verschmutzen die Umwelt jedoch weitaus weniger als die Geländewagen und Schneemobile, die von den Grenzern eingesetzt werden, um die Migrant·innen immer weiter und höher zu jagen. Die Verwischung ihrer Spuren trägt vielmehr zu ihrer Unsichtbarmachung bei und ermöglicht die Leugnung der menschlichen Dramen, die sich an unseren Toren abspielen.
Die Realität sichtbar machen
Wir beherbergen und pflegen weiterhin die in Not geratenen Menschen, sammeln Zeugenaussagen, dokumentieren Rechtsverletzungen und klagen vor Gericht, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg und mit demselben Ziel vor Augen. Es geht darum, die Realität sichtbar zu machen: Grenzen töten – damit finden wir uns nicht ab. Das ist der Sinn der «Commémor'Action», der Verschwundenen zu gedenken und im Alltag dafür zu kämpfen, dass jeder Mensch, egal woher er kommt, sich gleichberechtigt mit den Menschen der reichen Länder frei bewegen kann.
Die Stadt Briançon und ihre Umgebung müssen ein Gebiet sein und bleiben, das einen menschlichen Empfang für Geflüchtete gewährleistet. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Der Kampf des Dorfes Riace in Kalabrien mit seinem Bürgermeister Mimmo Lucano, der heute Mitglied des Europäischen Parlaments ist, gibt uns ein Beispiel dafür. Und die viele Unterstützung, die wir erhalten, verpflichtet uns dazu, beharrlich weiterzumachen. Wir danken allen dafür.
Anne Gautier, Tous Migrants und Médecins du Monde
Alle Informationen auf der Website www.commemoraction.net
Cairn (von Schottisch-Gälisch), gebräuchlich v.a. auf den Britischen Inseln und in Frankreich = Steinmal