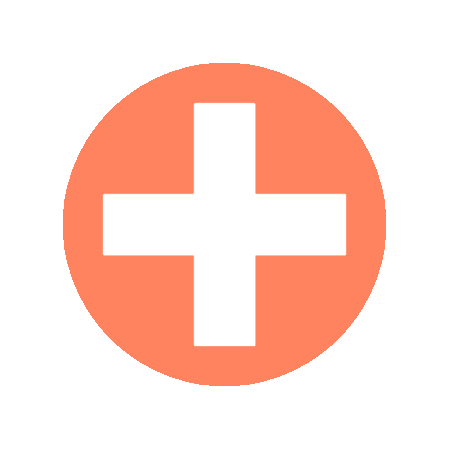Vor 500 Jahren fand die wohl grösste Massenerhebung in Europa für eine gerechtere Gesellschaftsordnung statt, die als «Bauernkrieg» in den Geschichtsbüchern steht. Die bäuerliche Bevölkerung trug damals die Hauptlast zur Aufrechterhaltung der Feudalgesellschaft. Ist die aktuelle Ausbeutung der Natur und die Bedrängung indigener Gruppen eine globale Fortsetzung der Ereignisse vor 500 Jahren? 2. Teil
Als prototypisches Beispiel für die ursprüngliche Akkumulation, also für den systematischen Raub von Land, gilt die Durchsetzung der Weidewirtschaft in England, beginnend mit dem späten 15. Jahrhundert. Damals gelang es den britischen Gutsbesitzern, Grund und Boden, der vormals zur Selbstversorgung gedient hatte, zu enteignen und für die Schafzucht und somit für die Wollproduktion in der aufstrebenden Textilindustrie zu nutzen. Das Land wurde buchstäblich eingehegt. So wurde der bekannte Spruch «Schafe fressen Menschen» geprägt – die Schafzucht der Grossgrundbesitzer wurde zum Symbol für Verarmung und Hunger eines grossen Teils der bäuerlichen Bevölkerung in England. Ähnliche Einschränkungen für die Bauern und Bäuerinnen fanden zu dieser Zeit auch auf dem europäischen Festland statt.
Florian Hurtig ist Sachbuchautor und Bauer in einer solidarischen Landwirtschaft, also einem Zusammenschluss von Produzent·innen und Konsument·innen im Dorf Alfter bei Bonn. In seinem demnächst erscheinenden Buch über die Bauernkriege geht er ausführlich auf die damaligen Ereignisse und ihre Bedeutung für die heutige Zeit ein: «Mit dem aufkommenden Absolutismus ging's den Bäuerlichen wieder Schritt für Schritt schlechter, d.h. es wurden mehr Steuern erhoben. Das Bestreben der Herrschenden war, alle Bauern und Bäuerinnen in einen gleichen Status zu bringen, und zwar den Status der Leibeigenen, denen es am schlechtesten ging. D.h. es wurden dann mehr Frondienste verlangt, höhere Steuern und eben die Allmenden, die vor allem für die ärmeren Bauern und Bäuerinnen wichtig waren, die wurden weggenommen. Und das alles hat dazu geführt, dass es die grosse Explosion gab und Menschen massenhaft revoltiert haben.»
Im Frühjahr 1525 hatte dieser «Aufruhr», wie die Zeitgenossen den Aufstand nannten, seinen Höhepunkt erreicht. Einige Monate lang triumphierten die revoltierenden Bauern und Bäuerinnen. Autorität und Herrschaft brachen zusammen, die vertrauten Strukturen des Heiligen Römischen Reiches wurden umgestürzt, die Brüchigkeit der bestehenden sozialen und religiösen Hierarchien trat offen zu Tage. Die Menschen, so schreibt die Historikerin Lyndal Roper in ihrem monumentalen Buch über den Bauernkrieg, begannen sogar, von einer neuen Ordnung zu träumen.
Florian Hurtig stellt dazu fest: «Im April und Anfang Mai 1525 gab's Phasen, in denen ganze Landstriche von Bauernhaufen kontrolliert wurden, die tatsächlich auch eine Art Lokalregierung gegründet hatten. Und dann kam der schwäbische Bund. Das war ein Zusammenschluss von allen Grundherren im Schwäbischen Bereich. Die hatten ein Heer aufgestellt, sind damit losgezogen und haben nach und nach die Bauernhaufen niedergeschlagen. Viele sind in die Schweiz entflohen, und da gab's dann ganze Clubs von ehemaligen Bauernkriegern, wo sich dann die überlebende Elite der Bauernkrieger in der Schweiz versammelt hat und dann nochmal 1526 nach Österreich gezogen ist, um den Aufstand zu entfachen.»
Gottes Schöpfung gehört allen
Der Blutzoll bei der Niederschlagung der Bauernrevolten war gewaltig. Zwischen siebzig- und hunderttausend Menschen wurden von den Truppen der Fürsten niedergemetzelt. In diesem blutigen Sommer starb etwa ein Prozent der Bevölkerung des Kriegsgebiets – ein enormer Verlust an Menschenleben in wenigen Monaten. Thomas Müntzer, der bekannteste Anführer der Bauernheere, wurde am 15. Mai 1525 nach der Schlacht bei Frankenhausen in Thüringen gefangen genommen und in der Festung Heldrungen festgehalten und gefoltert. Am 27. Mai 1525 wurde er vor den Toren der Stadt Mühlhausen enthauptet, sein Leib und sein Kopf wurden zur Abschreckung zur Schau gestellt.
Die Vision, welche die Bauern und Bäuerinnen antrieb, handelte von der Beziehung des Menschen zur Schöpfung, und deshalb sei sie auch heute noch von Bedeutung, schreibt die Historikerin Lyndal Roper. Die Menschen waren wütend darüber, dass die Grundherren das Eigentum an den natürlichen Ressourcen, dem Wasser, dem Gemeindeland und den Wäldern für sich beanspruchten, obwohl diese zu Gottes Schöpfung und damit allen Menschen gehörten. Sie waren wütend darüber, dass die Herren ihnen ihre Freiheit gestohlen hatten und beanspruchten, sie zu besitzen. Doch Christus hatte, wie Luther zeigte, uns alle mit seinem kostbaren Blut freigekauft. Auch wenn die Kämpfe gegen Landraub und Unterdrückung heute meist nicht religiös begründet werden, so sind sie in globalem Massstab keineswegs verschwunden, wie die Kultur- und Sozialanthropologin Lisa Francesca Rail betont: «Wie ist das heute? Ich würde sagen, auch heute stehen Bauern und Bäuerinnen, aber auch andere Menschen, die landwirtschaftlich tätig sind, also Hirten und Hirtinnen, Landarbeiter·innen, Fischer und Fischerinnen etc. auf der ganzen Welt massiv unter Druck, von ihrem Land und ihrer Arbeit leben zu können, also ein angemessenes Einkommen zu erstreiten, ein Auskommen zu erstreiten. Und auch bei heutigen Bauernprotesten und -kämpfen geht es in der Regel um ein Aufbegehren gegen Ausbeutung und Abhängigkeiten, auch wenn die, gegen die man sich wendet, keine Feudaladeligen mehr sind.»
Und heute?
Heute richtet sich der Protest meist gegen mächtige Agrarmultis, Saatgutkonzerne, Düngemittelhersteller und Supermarktketten. Im Globalen Süden, etwa in Ländern Lateinamerikas, Afrikas oder in Indien geht es dabei nicht selten um Leben und Tod. In Europa ist der Überlebenskampf der Bauern und Bäuerinnen zwar weniger lebensbedrohlich, dennoch setzen ihnen Marktstrukturen stark zu. Um ihre Anliegen gemeinsam zu vertreten, haben sich bäuerliche Organisationen in einem weltweiten Bündnis zusammengeschlossen, wie Franziskus Forster, Politikwissenschaftler und Lektor an der Universität für Bodenkultur in Wien, erklärt:
«Und in unserer Bewegung La Via Campesina – die 200 Millionen Mitglieder weltweit und Organisationen auf nahezu allen Kontinenten, in Lateinamerika, in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern umfasst – da schliessen sich Gruppen zusammen, um gemeinsam für Ernährungssouveränität einzutreten. Das ist das Recht von Menschen, die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, wie produziert wird, wie konsumiert wird, wie Lebensmittel verteilt werden, selbst zu bestimmen und dabei die Fragen des Zugangs zu Land, des kleinbäuerlichen Zugangs zu Saatgut, zu Wasser und vielen anderen elementaren Ressourcen ins Zentrum zu stellen.» Die bei Weitem wichtigste kapitalismuskritische Bewegung kommt heute bemerkenswerterweise nicht aus der Arbeiter·innenschaft, sondern von Bauern und Bäuerinnen. Die «Via Campesina» – auf deutsch «der bäuerliche Weg» – wurde im Jahr 1992 gegründet und vereint Millionen Kleinbauern und -bäuerinnen, Landarbeiter-innen, Fischer-innen, Landlose und Indigene aus über 80 Ländern. Ihre Anliegen haben grosse Dringlichkeit – denn die bäuerliche Welt droht zu verschwinden, und mit ihr die Biodiversität und die regionale Versorgung, wie Lisa Francesca Rail betont: «Ganz konkret geschieht Ausbeutung von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, heute durch ungleiche Marktmacht gegenüber den vor- und nachgelagerten Industrien, d.h. gegenüber Maschinenherstellern, gegenüber Saatgutvertreibern, gegenüber verarbeitenden Betrieben wie Molkereien oder Mühlen, oder gegenüber den Supermärkten. Um das plastisch zu machen: Wenn es einfach nur eine Molkerei in der Umgebung, in der Region gibt, die grössere Mengen an Rohmilch abholt, dann kann diese Molkerei diesen Höfen Standards, Abholfrequenz und auch teilweise den Preis angeben, weil die Betriebe, gerade die, die grosse Mengen an Milch haben, davon abhängig sind, dass dieses verderbliche Produkt abgeholt und ihnen abgekauft wird.» Bei den heutigen bäuerlichen Widerstandsbewegungen geht es nicht um eine Verklärung und Romantisierung des Landlebens vergangener Zeiten. Das Leben im Dorf war auch hierzulande in vielerlei Hinsicht alles andere als idyllisch. Bis in die Nachkriegsjahrzehnte herrschten verkrustete patriarchale Strukturen vor. Doch angesichts der anhaltenden Abwanderung in die Städte scheint es heute wichtiger denn je, die Arbeit in der Landwirtschaft auch für junge Menschen attraktiv zu machen und aufzuwerten – das könne nur gelingen, wenn die Marktmacht der Supermarktketten zurückgedrängt werde, meint Lisa Francesca Rail und fährt fort: «Und ähnliches gilt, wenn wie in Österreich wenige Grosshandelsketten den Lebensmitteleinzelhandel massiv dominieren. In Österreich teilen sich drei Konzerne über 80 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels auf, die haben auch massive Markmacht gegenüber den Produzent·innen.»
Diesem Befund schliesst sich auch der Landwirt Florian Hurtig aus Nordrhein-Westfalen an: «Und das Problem ist natürlich, dass man für die landwirtschaftlichen Produkte heute nicht die Preise bekommt, die man benötigt, und man deshalb auf Masse gehen muss. Und eigentlich nur mehr von den Subventionen leben kann und das eben Flächenförderungen sind. D.h. wer viel Fläche hat, kann davon überleben und Kleine nicht. Und das würde ich als das Hauptproblem der heutigen Zeit ansehen, dass im Prinzip die grossen Supermarktketten den ganzen Lebensmittelbereich in der Hand halten.» Das Preisdumping wirkt sich nicht nur auf die Produzenten negativ aus, sondern – als letztes und oftmals schwächstes Glied in der Produktionskette – auch auf die Landarbeiter·innen, wie in Südspanien etwa, wo in der Region Almería hunderttausende entrechteter Arbeitsmigrant·innen unter Plastikplanen schuften, damit die Supermärkte auch im Winter Gurken, Paprika und Tomaten anbieten können.
Thomas Müntzer und die Bauern, mit denen er paktierte, wollten auf Luthers Reformation der Kirche eine Revolution der sozialen Beziehungen folgen lassen, «Christen, Juden, Moslems und Heiden» zählte der universalistische Müntzer zu den Anwärtern auf Gottes Heil. Die damaligen Ereignisse scheinen in weite Ferne gerückt. Doch noch immer stammen 70 Prozent der globalen Nahrungsmittelproduktion von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. An ihr Überleben sind drängende Probleme unserer Zeit geknüpft: der Schutz von Klima und Biodiversität, der Erhalt von landwirtschaftlichem Boden als wichtigen Kohlenstoffspeicher und dem Abbremsen der Verstädterung. Nicht zuletzt geht es um unser tägliches Brot.
Alexander Behr
Dieser Artikel ist der 2. Teil der Transkription einer Radiosendung von Alexander Behr (EBF-Österreich) mit dem Titel «500 Jahre Bauernkriege – Widerstand gegen Landraub und Ausbeutung» der Reihe «Dimensionen». Die Sendung wurde am 15.04.2025 im Österreichischen Rundfunk auf Ö1 ausgestrahlt.